– Der Paradiesfisch –
Macropodus opercularis
von Heinz Bela
Verbreitung und Biotop:
Beheimatet ist unser Paradiesfisch in Südostasien – Ostchina, auf Hainan und in Nordvietnam.
Bevorzugt ist er in flachen, stehenden, oder manchmal auch in langsam
fließenden Gewässern zu finden, die sehr stark verkrautet sind.
Gelegentlich sind auch überflutete Reissümpfe ein idealer Lebensraum.
Beschreibung:
Kommen wir nun zur Färbung unserer bis zu 12 cm langen Makropoden. Der
Körper der Paradiesfische ist gestreckt und seitlich flach. Die
Grundfarbe, die von neun bis 15 vertikalen Streifen durchzogen ist,
kann bräunlich oder karminrot sein. Bei einer grünlichen oder blaugrauen Körperfarbe sind die Querstreifen jedoch karminrot.
 |
After- und Rückenflossen können bräunlich oder bläulich sein, mit
verschiedenfarbigen Tupfen, die mit einem hellen Rand abschließen. Die
Schwanzflosse ist beim Imponieren weit gespreizt, mit lang ausgezogenen
Spitzen. Ein Karminrot ist die vorherrschende Farbe, mit weißlichen
Streifen. Auch eine bräunliche Grundfärbung mit bläulichen Streifen
kann vorhanden sein. Die Brustflosse ist meist bläulich bis grünlich,
wobei die ausgezogenen Spitzen gelb oder hellrot sind. Der Kopf ist mit
schwarzen Strichen gezeichnet; die Kehle zeichnet sich durch eine
braune Färbung aus. Auf dem Kiemendeckel befindet sich ein Augenfleck.
Die Weibchen bleiben etwas kleiner und sind heller gefärbt. Man sagt,
dass sie nur rote Querstreifen haben. Ich hatte auch einige Tiere mit
hellblauen Querstreifen. Auch sind die Flossen nicht so großvolumig
ausgefallen wie bei den Männchen.
Bei den
Paradiesfischen gibt es auch noch eine Farbvariante – und zwar Albinos.
Hierbei ist die Grundfarbe Weiß, was eigentlich aber eher als ein
helles Gelb oder fleischfarben erscheint; doch sind die Querbänder
auch hier hellrot. Zudem sind hier die Augen rot, da in der Iris keine
Farbpigmente vorhanden sind und der Augenhintergrund, welcher stark
durchblutet ist, sichtbar wird.
Pflege und Zucht:
Zwei M. opercularis-Paare setzte ich in ein 40 Liter fassendes
Aquarium. Das Aquarium war mit einem üppigen Pflanzenwuchs ausstattet,
der mit einer lockeren Schwimmpflanzendecke abschloss. Da unsere
Makropoden keine großen Ansprüche ans Wasser stellten, gaben sie sich
mit Duisburger Leitungswasser zufrieden. Die Temperatur betrug 26 °C.
Nach vorheriger guter, kräftiger Fütterung zeigten die Weibchen einen
guten Laichansatz.
Schon am nächsten Tag bauten beide
Männchen an entgegengesetzten Seiten ihr Schaumnest. Das Schaumnest war
sehr flach, aber großflächig. Einen weiteren Tag später, abends um
17.00 Uhr, begannen die ersten Scheinpaarungen. Das Weibchen schwamm
immer wieder das Männchen an, das
aber zu sehr mit dem Bau des
Nestes beschäftigt war. Gönnte sich das Männchen kurz einmal eine Pause
und begutachtete sein Schaumnest, so kam sofort das Weibchen
angeschwommen, stupste dem Männchen in die Seite, um ihm zu zeigen,
dass es laichwillig war.
 |
 |
|
Macropodus opercularis – Umschwimmen
|
Macropodus opercularis – Umschwimmen
|
In diesem Zustand änderte das Weibchen seine Farbe. War es vorher
ziemlich dunkel, so wurde es nun sehr hell, fast durchscheinend. Das
Männchen zeigte dagegen „voller Stolz“ seine bis zum Zerreißen
gespannten Flossen und erglühte in den schönsten Farben. Besonders
schön kamen jetzt die grünen Querstreifen zum Vorschein. Der Leib des
Männchens bog sich leicht um das Weibchen, aber nur zaghaft, ohne es zu
umklammern, um sich danach sofort wieder zu lösen und das Weibchen
wegzujagen, um sich wieder intensiver dem Nestbau zu widmen.
Nebenbei wurde das andere Paar mit gespreizten Flossen und
Kiemendeckeln verjagt. So vergingen etwa zwei Stunden. Das Weibchen
wurde immer öfter akzeptiert und es kam zur Scheinpaarung, aber immer
noch ohne Eiabgabe. In dieser Phase begutachtete das Weibchen das Nest,
spuckte auch Schaumperlen in die zukünftige Kinderstube und zupfte hier
und da an den Schwimmpflanzen. Sehr intensiv beobachtete es das andere
Paar. Sobald eine der anderen Makropoden dem Nest zu nahe kam, wurden
beide mit gespreizten Kiemendeckeln bedroht und verjagt, wobei sie vom
Männchen unterstützt wurde.
Endlich war es soweit, das
Männchen erstrahlte mit gespreizten Flossen in seinen schönsten Farben
und umschloss das Weibchen mit seinem ganzen Körper. Beide drehten sich
so, dass die Geschlechtsöffnungen zur Wasseroberfläche zeigten und
unter zitternden Bewegungen wurden Eier und Samen ins Wasser abgegeben.
Langsam stiegen die Laichkörner – da sie leichter als Wasser sind – zur
Wasseroberfläche ins gemachte Nest.
 |
 |
|
Macropodus opercularis – Paarung
|
Macropodus opercularis – vor der Paarung
|
Das Weibchen löste sich nach der Laichabgabe sofort vom Männchen,
schaute sich um, ob auch ja kein Störenfried in der Nähe war; wenn ja,
so wurde er aggressiv verjagt. Das Männchen verharrte noch einige
Sekunden in dieser gebogenen Körperhaltung, um anschließend die nach
oben schwebenden Laichkörner mit dem Maul aufzunehmen und diese an
einer geeigneten Stelle des Nestes hinein zu spucken. An dieser
Tätigkeit beteiligte sich auch das Weibchen – wenn es Zeit hatte, denn
seine Hauptaufgabe war die Revierverteidigung. Bei jedem einzelnen
Laichvorgang wurden nur etwa fünf bis zwölf Laichkörner ins Wasser
abgegeben.
 |
 |
|
Macropodus opercularis – Aufnehmen der Eier ins Maul
|
Macropodus opercularis – Laichakt, Ausschnitt
|
Zwischen jedem Liebesakt wurde immer wieder am Nest gearbeitet. Einmal
wurden die Schwimmpflanzen verschoben oder neue Luftperlen in die
Kinderstube gespuckt. Nach etwa 2,5 Stunden war das Weibchen
ausgelaicht und wurde nun als möglicher Störenfried vom Männchen
verjagt. Unermüdlich ging die Arbeit am Nest weiter und selbst die
Laichkörner wurden umgeschichtet. Auch konnte man immer wieder
beobachten, dass das Männchen Wasserfontänen ins Nest spuckte, die
circa drei cm hoch spritzten.
 |
 |
|
Macropodus opercularis – Embryo (Kopf und Auge)
|
Macropodus opercularis – Larve, Schlupf
|
Nachdem ich sicher war, dass die Weibchen ausgelaicht waren, fing ich
diese heraus, um den Männchen mehr Ruhe zu gönnen, da in der
Zwischenzeit auch das zweite Paar abgelaicht hatte. Jetzt trat doch ein
bisschen mehr Ruhe ein. Kamen sich die Männchen doch einmal zu nahe, so
wurden nochmals die Flossen zum Zerreißen gespannt und es kam zum
Maulzerren – wie bei den Barschen. Beide Männchen aber waren mit der
Pflege des Laiches und nach etwa 30 Stunden mit der Betreuung der
Jungbrut ausgelastet.
 |
 |
|
Macropodus opercularis – Larve, Schlupf
|
M. opercularis – Larve, 1. Tag nach dem Schlupf
|
Unermüdlich wurde versucht, die frisch geschlüpfte Makropodenbrut
zusammenzuhalten, was aber nur bis zu dem Zeitpunkt klappte, wo der
Dottersack noch vorhanden war. Anschließend ging die Brut auf
Futtersuche, der Schwarm schwamm auseinander und sämtliche Bemühungen
des Männchens, denselben zusammenzuhalten, schlugen fehl. Das war nun
auch der Augenblick, die Männchen herauszufangen und die Brut zu
füttern. Verfüttert wurden Pantoffeltierchen, da Salinenkrebse noch zu
groß waren. An den prallen, gräulich aussehenden Bäuchen erkannte ich
ihren guten Appetit. Nach zwei Tagen wurden Nauplien der Salinenkrebse
gereicht und mehr und mehr erkannte man an den rosa umgefärbten
Bäuchen, dass der Futterwechsel stattgefunden hatte.
Das Wachstum war zufrieden stellend und es konnte auf Cyclops und
kleine Wasserflöhe sowie fein zerriebenes Trockenfutter zurückgegriffen
werden
 |
|
M. opercularis – Larve, 1. Tag nach dem Schlupf
|
Fazit:
Abschließend kann man sagen: Der Paradiesfisch, Macropodus opercularis,
ist ein wunderbarer Fisch, den es lohnt zu erhalten. Er ist farblich
und von seiner Flossenpracht her sehr ansprechend, ein Allesfresser und
sehr genügsam. Was wollen wir mehr?!
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der ATInfo.



































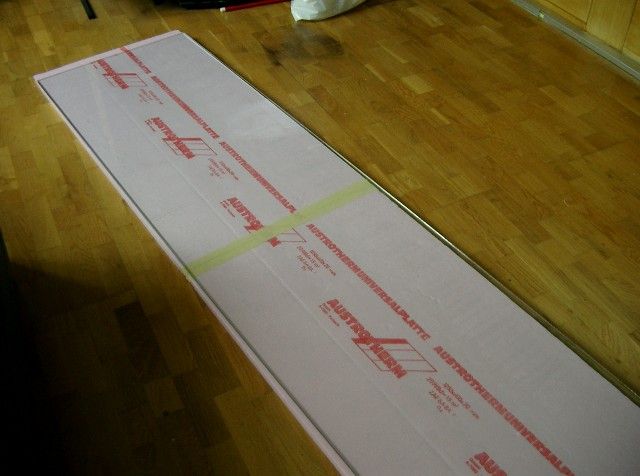












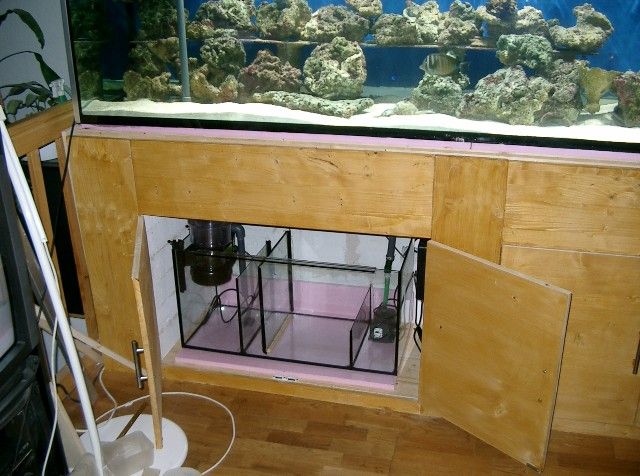

 100x
100x 400x
400x 1000x ohne öl
1000x ohne öl